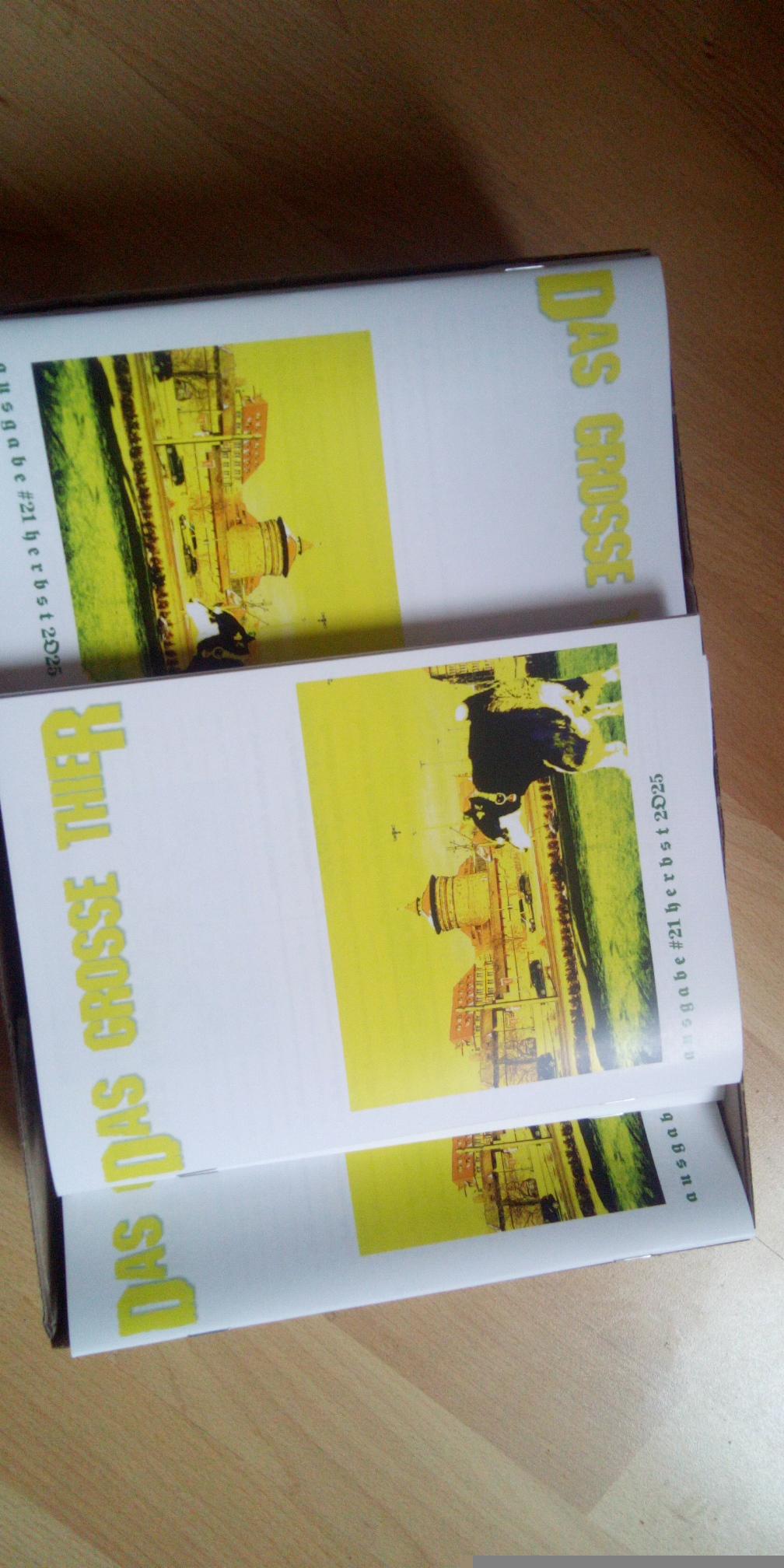[An dieser Stelle reichen wir einen Text aus dem Heft# 17/2021, der damals unter den Tisch gefallen ist. Die Ausgaben kann man übrigens auch online lesen. Lasst uns dieses Thema nicht aus den Augen verlieren. – GT]
Denke ich an den Stand der Diskussion über „alternative Wirtschaftsmodelle“, so sehe ich vor mir, wie WachstumsgegnerInnen und UmweltschützerInnen gemeinsam verschiedene Paragraphen zur Einschränkung bzw. Förderung jeweils schlechter bzw. guter Sachen vorbereiten (1). Diese Reformvorschläge bringen sie zeitgemäß in Petitionen ein. Dementsprechend zeigt die Konjunktur von Vereinen wie Campact, wie Protest funktioniert bzw. was Protest heute zu bieten hat. Der Appell an die staatliche Reglementierung der allzu sichtbaren Schweinereien zeigt, wie weit weg der Ort des Geschehens bzw. der adressierte Missstand den AktivistInnen und kritischen KonsumentInnen erscheint.
Nur ein Teil der Empörten kümmert sich, statt um die falsche Konsumption von Waren, um deren Erzeugung. Änderungen in der Produktion versprechen sie sich letztlich dennoch von gesetzlichen Limitierungen (2), wobei die privatwirtschaftliche Unternehmung selbst nicht in Frage gestellt wird – dem gierigen Management aber dennoch der Spielraum genommen werden soll.
Wenn doch mal über die ArbeiterInnen gesprochen wird, dann aus anderer Perspektive: Die Diskussion dreht sich um das Arbeitsverhältnis und die Arbeitsbedingungen, endet jedoch vor dem Ziel und dem Ergebnis der Beschäftigung. In dieser Denke sind Betriebsräte jene Leute, die sich um die Unterlagen für die Kündigung oder Neueinstellung kümmern und gelegentlich die Arbeitssicherheit und den Datenschutz ansprechen. Die Belegschaften als Interessengruppen sind derzeit jedoch nur in Ausnahmefällen Sphären politischer Auseinandersetzung. Dass Arbeitskräfte tatsächlich in Relation zu den Produkten bzw. Leistungen gedacht werden, kommt selten vor. So entfremden sich die ArbeiterInnen nicht nur vom Resultat ihrer Arbeit; sie verschwinden in der öffentlichen Wahrnehmung auch noch hinter ihrem Produkt. Das ist nicht neu: Hitler hat die Autobahnen schließlich auch alleine gebaut.
Das Unbehagen in der Waren produzierenden Gesellschaft artikuliert sich viel häufiger als Kritik der KonsumentInnen am Angebot (Auto zu groß, Huhn zu unglücklich, Strom zu nuklear), denn als Kritik der ArbeiterInnen an ihrem Auftrag. Der Protest leitet sich also aus dem Privaten ab, wo wir mit dem Auto fahren, ein Spiegelei essen und das Auto aufladen. „Politischer Aktivismus findet in Deutschland meist nach Feierabend statt, gern auch am Wochenende und anlässlich von Groß-Events. Der Arbeitsplatz gilt als tendenziell unpolitischer Raum, für die herrschende Klasse steht er auch außerhalb der Demokratie.“ (Wigand, Rote Hilfe 3/2020)
Uns geht es hier weniger um das Demokratieverständnis der Arbeitgeber, mehr um das von uns ArbeitnehmerInnen selbst. Sich als potenzielleN politischeN AkteurIn qua Lohnarbeit zu verstehen bietet den Raum, abseits von der Rolle als Wahlvieh und KonsumentIn einen Handlungsspielraum zu entdecken, der nicht unmittelbar von Staat und Kapital (so) vorgezeichnet ist. In diesem Sinne soll auch der Titel dieses Textes erinnern ans das simple Credo: The systems works because you work (3). Weiterlesen