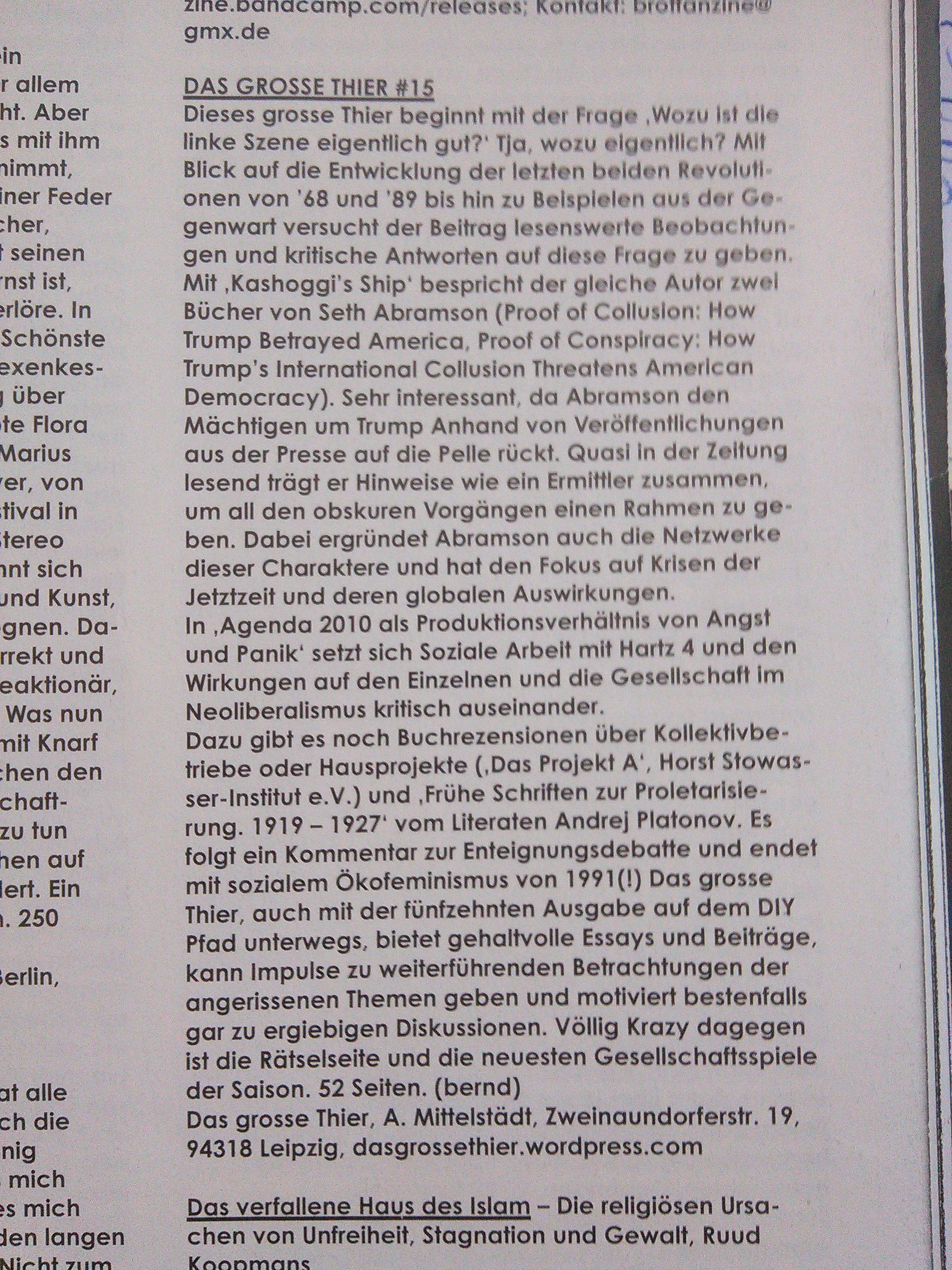Bücher
Aliza Marcus: Blood and Belief The PKK and the Kurdish Fight for Independence, New York University Press, 2007
Abdullah Ocalan,Janet Biehl, Dilar Dirik, Krzysztof Nawratek: Towards Stateless Democracy. Ideological Foundations Of Rojava Autonomy And The Kurdish Movement In Turkey, CCBYSA FreeLab 2015
Ali Kemal Özcan: Turkey’s Kurds A theoretical analysis of the PKK and Abdullah Öcalan, Routledge 2005
Anja Flach, Ercan Ayboğa, Michael Knapp Revolution in Rojava, VSA-Verlag, 2015
Thomas Schmidinger: Rojava Revolution, War, and the Future of Syria’s Kurds, Pluto Press, 2018
Carlos Munzer – Abu Muad – Abu Al Baraa: Syria Under Fire. A Bloodied Revolution, Editorial Socialista Rudolph Klement, 2017
Anarchist Initiative From Koridalos Prison: Syrian Revolution, https://libcom.org/library/syrian-revolution-perspective-korydallos-prison-greece
Aufsätze
Self-organization in the Syrian people’s revolution – IV Online magazine – 2013 – IV462 – July 2013 – http://internationalviewpoint.org/spip.php?article3025
Leila Shami, The life and work of anarchist Omar Aziz, and his impact on self-organization in the Syrian revolution https://tahriricn.wordpress.com/2013/08/23/syria-the-life-and-work-of-anarchist-omar-aziz-and-his-impact-on-self-organization-in-the-syrian-revolution/
N.N., The Most Important Thing: Two speaking tours and the Syrian Revolution, https://libcom.org/library/most-important-thing-two-speaking-tours-syrian-revolution
Jesse McDonald, The Syrian Social Nationalist Party’s (SSNP) Expansion in Syria,
https://www.joshualandis.com/blog/the-syrian-social-nationalist-partys-ssnp-expansion-in-syria-by-jesse-mcdonald-jjmcdonald10/
SYRIA: On the Syrian Revolution and the Kurdish Issue – an interview with Syrian-Kurdish activist and journalist Shiar Nayo, https://tahriricn.wordpress.com/2014/04/07/syria-on-the-syrian-revolution-and-the-kurdish-issue-an-interview-with-syrian-kurdish-activist-and-journalist-shiar-nayo/
Michael Karadjis: US vs Free Syrian Army vs Jabhat al-Nusra (and ISIS): History of a hidden three-way conflict, Marxist Left Review No. 14, Winter 2017, https://marxistleftreview.org/articles/us-vs-free-syrian-army-vs-jabhat-al-nusra-and-isis-history-of-a-hidden-three-way-conflict
Wenn man versucht, über Syrisch-Kurdistan etwas neues herauszufinden, indem man in der neueren Literatur über die PKK und über die syrische Revolution seit 2011 herumsucht, stösst man auf eine Reihe von Fragen, die immer wieder auftauchen, immer miteinander verbunden, und die vermutlich immer wieder, auf andere Weise, auftauchen werden. Ich versuche sie mal, herauszusortieren.
1.
Die PKK ist entstanden in der an Verrückten gar nicht armen türkischen radikalen Linken der 1970er. Ihre innere Struktur wird oft als stark zentralistisch beschrieben, aber der komplexe Prozess, in dem sie sich herstellt, ist viel bemerkenswerter, als dass er damit beschrieben wäre. Die Konflikte um die Führung innerhalb der PKK bringen Abdullah Öcalan an die Spitze; die Konflikte innerhalb der türkischen Linken bringen gleichzeitig die PKK in eine Art Isolation, aber sie räumt um sich herum gleichzeitig grossflächig ab. Die bevorzugte Methode, konkurrierende Organisationen zu bekämpfen, ist der Meuchelmord. Ziemlich lange wird mit der PKK niemand zusammenarbeiten wollen, bis zu dem Tag, als man dazu gezwungen ist; aber da war es zu spät.
Die Strategie war sehr kompromisslos und sehr kühn, und es gehört Glück dazu, dass sie aufgeht. Es liessen sich wahrscheinlich unzählige Organisationen aufzählen, die nicht dieses Glück hatten und für die eine ähnliche Strategie in der Bedeutungslosigkeit geendet hat; aber die meisten sind natürlich völlig vergessen worden. Dem Glück, das die PKK hatte, kam entgegen, dass sie vielleicht etwas erkannt hatte, was der Rest nicht erkannt hatte, nämlich die Bedeutung der sogenannten kurdischen Frage betrifft.
Umgekehrt hatte die PKK die kurdische Frage auch nicht als rein nationale Frage aufgefasst, und das trennte sie wiederum von den kurdisch nationalen Parteien. Das gab ihr freie Hand, sich wahlweise auf das nationale Sentiment oder auf das soziale Dynamit zu stützen, das heisst praktisch alles auszunutzen, was die kemalistische Verfassung in der Türkei an Schwierigkeiten aufgehäuft hatte.
Dieser Vorrat einander widerstreitender Ideen ist an sich nichts ungewöhnliches, die SSNP in Gross-Syrien oder die arabische Ba’ath-Partei haben ähnlich angefangen. Anders als diese hatte die PKK nicht die Wahl, ihren Weg durch Unterwanderung des Militärs und Staatstreich zu gehen; es gab einfach keinen für sie tauglichen bestehenden Staatsapparat. Sie ging stattdessen denjenigen Weg, den die Maoisten den „Volkskrieg“ nennen; diesen begann sie 1983.
Für solchen „Volkskrieg“ ist die Beseitigung jeder Konkurrenz die erste Voraussetzung; deswegen brüten gerade solche Systeme maoistisch-militärische Aufstände geradezu aus, die der Guerilla diese Arbeit zu einem Teil abnehmen. Der Staatsstreich in der Türkei 1980 zerstörte die legale Linke und die ohnehin notleidende politische Szenerie des türkisch-kurdischen Südostens. Was an illegalen Organisationen die Verfolgung durch den Staat überlebte, war der Verfolgung durch die PKK ausgesetzt. Zuletzt stand die PKK als völlige Herrin über den einzigen vorhandenen Weg politischer Veränderung da.
Was die PKK mit den konkurrierenden Organisationen ausser ihr, machte ihr aufstrebender Anführer mit seinen Konkurrenten innerhalb. Für ihn war die Partei identisch mit ihm selbst, und er arbeitete rastlos, dass sie es wurde. Er wurde ein Meister darin, Funktionäre, vor deren Fähigkeiten er sich fürchtete, in Schwierigkeiten zu bringen, sie zu Schritten zu zwingen, die ihnen als Verrat ausgelegt werden konnten. Wer nicht erschossen wurde, den bekam er so in die Hand. Es wagte bald niemand, seinen zunehmend realitätsfernen Befehlen zu widersprechen.
Eine schöne Anekdote, die die fast karikaturhafte Egozentrik des geliebten Führers zeigt, gibt Marcus S. 266:
Sein Narzissmus schwappte in jeden Bereich über. Wenn er mit seinen Leuten in der PKK fussball spielte, wie er das oft tat auf dem Gelände in Damaskus, schoben die Spieler ihm wohlweislich den Ball rüber und passten auf, nicht im Weg zu stehen, wenn er ein Tor schiessen wollte. Aber er bestand darauf, dass jemand eine Liste führte, wieviele Tore er geschossen hatte. Einmal vergass der PKK-Kämpfer, der diese Liste führen sollte, vier von seinen Toren. Öcalan explodierte und schrie den Mann, einen erfahrenen Kämpfer aus der Provinz Botan, an. … Er fragte Mehmet, wieviele Tore er gemacht hatte, und Mehmet sagte: 12. Öcalan fing an zu schreien: Du Penner, wie kannst du vier von meinen Toren vergessen! Mehmet entschuldigte sich, aber Öcalan schrie weiter. Später am Tag, als Öcalan einen Vortrag halten sollte, war das erste, was er fragte: „Wo ist dieses Arschloch? Wie konnte er meine Tore vergessen? Vier Tore vergessen ist wie vier Kämpfer vergessen … und das ist dasselbe wie die Revolution zu vergessen und Kurdistan zu vergessen.“ Danach dachte ich ok, jetzt ist es endlich vorbei. An dem Abend wurde er auf Med TV interviewt. Und da fing er schon wieder an damit, und sagte „dieser Penner, dieser Penner von einem Leutnant, er hat vier von meinen Toren vergessen, wie kann man vier von meinen Toren vergessen?“
Man kann sich vorstellen, wie es in einer Organisation zugeht, wo die Spitze so aussieht. Auf dem freien Markt laufen einem solchen Chef die Leute natürlich davon, warum also nicht diesem? Manche Leute bemühen dann ein sogenanntes Charisma, aber das ist bekanntlich nicht eine Eigenschaft einer Person, sondern etwas, dass sie verliehen bekommt. Und die Fussballgeschichte zeigt ja auch, wie es damit bestellt war.
Es sind genug davongelaufen und erschossen worden, aber was hat die Leute dabeigehalten, die man brauchte, um sie zu erschiessen? Aber seibst die Anhänger haben natürlich meistens begriffen, was das für ein Verein war, und der psychotische Zug kann auch nicht gut übersehen werden. Wenn die türkische Armee ganze Landstriche entvölkert und die Bauern umsiedelt, weil die PKK mit Unterstützung dieser Bauern operiert hat, dann hat die Guerilla dann halt in der Gegend keinerlei Stütze mehr. Und dann bekommt man aus der Zentrale den Befehl, dann müsse man sich halt mehr anstrengen. Schönen Dank! Oder noch besser, dann müsse man halt von irgendwoher die Leute nehmen und die Mittel, um wie eine reguläre Armee zu kämpfen.
„Öcalan brüstete sich gerne, dass er, obwohl er nie auch nur einen Schuss getan hatte, mehr vom Krieg verstünde als seine erfahrensten Offiziere“, Marcus S. 240. Es ist schon bemerkenswert, dass man solchen ahnungslosen Angeber an dieser Position geduldet hat. Aber Bewegungen dieser Art bringen immer wieder solche Erscheinungen hervor, es ist vielleicht Zeit, dass man das nicht für ein bug, sondern ein feature hält. Marcus interviewt jedenfalls derart viele, die dabei waren, und solche, die davongelaufen sind, die alle ein ums andere Mal das gleiche sagen: für Kurdistan kämpfen, für die Befreiung kämpfen (der Bauern, der Frauen oder wessen auch immer), gegen das türkische Militärregime kämpfen etc., das ging nur mit der PKK und in der PKK; dass das ein ziemlich verrückter Verein ist, muss man hinnehmen und nimmt man lange hin. Das ist der Preis, den man zahlen muss.
Davon gibt es auch eine enthusiastischere Variante. Anfang der 1990er begann im Südosten und überall in den Städten eine grosse Welle von Protesten, massiven Demonstrationen und beinah Aufständen; und es ist merkwürdig und sehr instruktiv, wie und warum die revoltierende Jugend jetzt beginnt, ihre Loyalität auf die PKK zu richten; und zwar auf der einen Seite sehr hingebungsvoll, auf der anderen Seite aber keineswegs bedingungslos. Auf die vergleichweise kleine Organisation übt der riesige Zustrom von Anhängern durchaus einen gewissen Druck aus. Ab einem bestimmten Punkt der Popularität ist eine Organisation paradoxerweise auf einmal gezwungen, auf die öffentliche Meinung unter ihren Anhängern Rücksicht zu nehmen. Umgekehrt aber steigert sich der Machtkampf in genau dieser Phase, ebenso paradox, bis zum Fiederwahn. Denn der Massenanhang reisst an der Einheit der Partei, er setzt die vorhandenen Fliehkräfte frei. Die Organisation wird also keineswegs offener, sie wird nur immer straffer; ich möchte sagen Meuchelmord, gemässigt durch Opportunismus. Die Bühne, nämlich die türkisch-kurdische Politik, die die Partei unternommen hat zu monopolisieren, wird grösser; das heisst, die Anstrengung, sie zu monopolisieren, wird grösser.
Der Meuchelmord gegen Konkurrenten verschwindet auch nicht. Aber man hat es jetzt mit einer ganz anderen Lage zu tun. Es gibt nun eine Bewegung in der Gesellschaft des Südostens, mit der man zusammenarbeiten muss, aber die Interessen sind natürlich im strengen Sinne völlig gegensätzlich. Die Partei an sich hat hauptsächlich ihren Organisationsegoismus, ihre neuen Verbündeten aber praktizieren reale gesellschaftliche Interessen, und arbeiten für reale gesellschaftliche Veränderungen. Streng genommen sind die beiden Seiten einander Feind. Es ist gar nicht leicht, zu sehen, was sie zusammenhält.
Das Verhältnis ist überhaupt nicht eindeutig. Die Partei kalkuliert mit den Belangen der Gesellschaft und ihrer Anhänger genauso kalt, wie es der feindselige Staat auch tut; ihre Logik ist an sich dieselbe. Aber es drängt sich, wenn man durch die Arbeiten von Marcus, auch Schmidinger, geht, auch der Eindruck auf, dass die Anhänger versuchen, umgekehrt die Partei zu benutzen, der Partei ihre Zwecke aufzuzwingen, die Partei zu ihrem Organ zu machen. Es ist erstaunlich, weil es so gut dokumentiert ist, und weil es auf etwas hinausläuft, das eigentlich unmöglich ist. Kann es sein, dass nicht bloss die Partei die Gesellschaft zum Staat organisieren, sondern umgekehrt die Gesellschaft die Partei? Ich stelle die Frage nur zur Probe, ich habe keine Antwort.
Merkwürdig sind die Ereignisse um den 4. Kongress der PKK in Haftanin, Iraq, im Dezember 1990. Öcalan hatte Mehmet Sener damit beauftragt, auf diesem Kongress die obligatorischen Säuberungen durchzusetzen, das heisst Anklagen gegen einzelne Funktionäre vorzubringen, ihre Verfehlungen anzuprangern, Öcalans Meinung dazu zu referieren und ihre Verurteilung zu erzwingen. Das tat er auch, Marcus S. 146 ff., in einer „Atmosphäre des Terrors“. Aber dann tat er noch etwas viel weitergehendes, er ging über die einzelnen taktischen Fehler hinaus und stellte nicht die üblichen untergeordneten Funktionäre, sondern die Führung und Strategie im Ganzen in Frage, also den grossen Vorsitzenden selbst, und zwar ebenso wie immer unter ausgiebiger Berufung auf diesen selbst. Die Delegierten fanden die Vorschläge vernünftig, und stimmten dafür, weil es aussah, als wolle Öcalan es so. So brachte Sener eine grundlegende Kritik der Führung durch den Kongress, und verteidigte sie in einem offenen Brief innerhalb der Organisation; ein paar Wochen später wurde er in Damaskus umgebracht. Die Basis hatte ihm zwar Recht gegeben, aber zuletzt hatte sie die Einheit der Organisation bevorzugt, und das musste heissen: Öcalan folgen und Sener fallen lassen; wohl wissend, dass Sener Recht gehabt hatte.
Nicht anders geht die weitere Anhängerschaft auch mit Öcalan um. Manchmal hat man den Eindruck, dass man ihn zu einer Art Gott macht, bloss damit man seine irdische Existenz, seine Unfähigkeit, Arroganz und Egozentrik überhaupt erträgt. Man kann dann den himmlischen Öcalan nehmen, um ihn gegen den auf Erden zu halten. Als die Türken ihn zuletzt gefangen nehmen, muss seine Partei seine unwürdigen, geradzu kriecherischen Proklamationen vor Gericht ertragen, wo er den Kemalismus und den türkischen Staat preist; um seinen unersetzlichen Arsch zu retten und seine grosse Idee selbstverständlich, die an diesen gebunden ist, und die Partei muss es schaffen, sich zu diesem Zeug irgendeine grosse Strategie zu denken. Es zeugt von übermenschlicher Fähigkeit der Selbsttäuschung, dass es ihr gelang. Denn es entstand danach tatsächlich so etwas wie eine neue Strategie, der grosse Rat der PKK übersetzt sie aus Öcalans peinlichen oder kryptischen Proklamationen wie der delphische Priester die Orakelsprüche aus dem Lallen der Pythia.
Seit er gefangen aus Imrali sitzt, scheint Öcalan von allen Hindernissen befreit zu sein. Er ist jetzt auch, wie ein Heiliger oder ein Entrückter Imam, seinen Anhängern noch näher. Seine Person ist abstrakt geworden. Der Kult ist auf groteske Weise vollendet. In seiner Entrückung aber liest der Chef, und er liest Murray Bookchin, und sein Herz wird weich; der oberste Rat aber, der ihn auf Erden vertritt, liest die Zeichen der Zeit. Die türkisch-kurdische Gesellschaft zwingt der PKK einen merkwürdigen Kompromiss auf. Auf einem Kongress nach dem anderen gründet sie aus ihrem treu ergebenen Umfeld gross angekündigte gesellschaftliche Koalitionen, KADEK, Kongra-Gel usw., unter deren Schirm sie in Zukunft zu operieren verspricht; in der Struktur nicht anders als die klassisch leninistischen Frontorganisationen, gesteuerte Simulationen der gesellschaftlichen Tätigkeit. Und regelmässig gehen diese Organisationen wieder zu Bruch, und am anderen Ende erscheint wieder die identische PKK, unter ihrem angestammten Namen. Die Einbettung in die Gesellschaft misslingt, weil die Führung das Heft nicht aus der Hand geben kann. Aber sie muss es doch jedes Jahr aufs neue versuchen.
Im August 2003 erscheint ein merkwürdiges Dokument, eine Erklärung des Kongra-Gel, heute fast vergessen, vermutlich weil es so völlig aussergewöhnlich war. Darin heisst es recht unzweideutig: die Invasion der USA im Iraq ist gut, es wäre überhaupt zu wünschen, dass die USA sich mehr um die Demokratie im mittleren Osten kümmert. Ein separater Nationalstaat für die Kurden ist Unsinn, die Kurden haben im Gegenteil die nationale Berufung, in allen Staaten, in denen sie leben, föderative kommunal-demokratische Verhältnisse zu errichten, um einen demokratischen mittleren Osten und eine Welt jenseits von Staat und Nation herbeizuführen.
Man ist ja Öcalan irgendwie doch verpflichtet. Von allen volkstümlichen Parteiführern ist er ja dennoch der erste gewesen, der auszusprechen wagte, dass die jüdische Präsenz im mittleren Osten, d.h. Israel, legitim ist, und jeder Angriff auf sie ein Angriff auf den Mittleren Osten. Ohne Frage wird der Mittler Osten, wenn er einmal frei sein wird, dem Mann eine bronzene Statue errichten müssen. Aber man wird nicht vergessen dürfen, eine grosse erläuternde Tafel anzubringen. Bei all ihren merkwürdigen Veränderungen ist die PKK sich erstaunlich gleich geblieben, und es steht sehr in Frage, ob sie sich jemals grundlegend ändern kann; oder ob, trotz aller föderativen und basisdemokratischen Propaganda, die Bevölkerung sie in 20 Jahren wird davonjagen müssen. Ghaddafi und Chavez haben ganz ähnliche Propaganda getrieben. Beim einen wissen wir, wies ausging, den andern sehen wir uns demnächst an.
2.
In syrisch-Kurdistan zeigen sich an der Art, wie die PKK vorgeht, insgesamt erschreckende Ähnlichkeiten mit ihrem früheren Vorgehen in der Türkei. Das wirft eine grundsätzliche Frage auf. Denn die PKK hat ja allem Anschein nach dazugelernt und ihre Parteidoktrin völlig geändert. Aber vielleicht ist es gar keine Frage der Doktrin einer Partei, sondern der objektiven Existenz einer Partei?
Arbeiten wie die von Flach, Ayboğa, Knapp, die derzeit den Markt fluten, bestehen zum grösseren Teil aus Beschreibungen von Details in syrisch-Kurdistan, in denen sorgfältig der politische Kontext weggelassen ist. Diese Details mögen alle sogar richtig sein, die Lüge ist das, was nicht gesagt ist. Es gibt natürlich Fortschritt in syrisch-Kurdistan; aber was solche Literatur so unerträglich süsslich macht, was so sehr an die Nordkorea-Solidarität erinnert, ist, dass Gesellschaft und Partei unmittelbar als eins betrachtet werden. Den Fortschritt hat also die PKK gemacht. Sogar wenn die PKK das wäre, was sie nicht ist, so hätte sie ihn aber nicht gemacht, höchstens ermöglicht. Den Fortschritt haben die Kräfte der Gesellschaft gemacht. Und es wäre extrem auffällig, wenn diese gar nie in Konflikt mit der PKK gerieten.
Von solchen Konflikten, die selbst in der unschuldigsten Welt unausweichlich wären, weiss diese Literatur nichts, und das macht sie tief unglaubhaft. Sie schweigt, weil sie es nicht sieht, nicht weiss und nicht wissen will. In Wahrheit sind diese Konflikte alles andere als unschuldig. Die PKK, oder ihre syrische Inkarnation PYD, hat die linke syrisch-kurdische politische Bühne von aller Konkurrenz geräumt, wie früher die türkscih-kurdische, durch Meuchelmord; so an Michel Tammu. Übrig geblieben sind wohlweislich nur die konservativen Parteien, die in der sozialen Bewegung keine Konkurrenz sind.
Die PKK hat den Norden Syriens 2011 von dem Regime abgetreten bekommen. Die PKK hat eine Präsenz in Syrien seit den 1980ern. Wer von Syrien irgendetwas weiss, weiss, dass man nicht einfach so eine Präsenz in Syrien hat. Das Regime hat jede Organisation, die es geduldet hat, benutzt, und wen es nicht benutzen konnte, hat es zerstört. Man frage einmal die PLO, wie es ihr ergangen ist, als sie sich geweigert hatte, zu tun, was Assad nach 1981 verlangt hatte. Assad liess von ergebenen Leuten einfach eine neue PLO gründen, bewaffnete sie und liess die richtige PLO aus dem Land treiben. Danach begann er, die palästinensischen Flüchtlingslager des Libanon zu belagern, um die PLO zu vertreiben und seine eigene PLO zu installieren. Der berüchtige Lager-Krieg von 1983 war die Folge. Davon habt ihr nie gehört? Ich weiss. Wir schon.
Der führende syrische Geheimdienst, der Geheimdienst der Luftwaffe, pflegt seit jeher Organisationen, die er unterstützt, zu instrumentalisieren, auszuhöhlen und in Werkzeuge zu verwandeln, so ganze Parteien der libanesischen und palästinensischen Politik, die Amal, die PFLP-GC, oder die armenische Dashnaktsuyun, oder selbst die SSNP, die in Syrien abwechselnd verboten und in der Regierung ist. Er züchtet sich sogar eine eigene Scheinopposition. Verbündete, die eigenen Willen entwickeln, werden zerstört, wie Kamal Junblatt 1977 oder die libanesische KP 1987.
Was für eine infame Lüge bei Flach, Ayboğa, Knapp, dass die syrischen Kurden nach dem Aufstand von 2004 sich in der PKK gegen den Staat organisiert hätten und von hier aus eine glatte Linie bis 2011 führt. Die PKK betätigte sich in Syrien als ein verlängerter Arm des Luftwaffengeheimdiensts wie jede andre zugelassene Organisation. Man soll sowas Leuten erzählen, die vom syrischen Regime und dem libanesischen Krieg niemals Muh oder Mäh gehört haben.
2011 gab es gemeinsame kurdische und arabische Demonstrationen in Nordsyrien gegen das Regime. Das Regime hat damals beschlossen, der Revolution in den arabischen Landesteilen militärisch entgegenzutreten; aber, früher hätt man es „Frontbegradigung“ genannt, in den kurdischen Landesteilen übergab es die Verwaltung an die PKK. Man kann bei Jesse McDonald nachlesen, wie es ganz analog die SSNP behandelte: indem es sie in die Regierung hineinnahm.
Jetzt kann man mit dem grossen Rätselraten beginnen: aber verfolgt nicht die PKK eigene Zwecke auch? Was sie tut, ist ja nun nicht vorherbestimmt dadurch, dass sie früher lange mit dem Assad-Regime zusammengarbeitet hat! Das ist richtig, aber irrelevant, weil ein Apparat wie die PKK eine black box ist, dessen inneres man nur aus den Umständen erraten kann, statt die Umstände aus diesem Inneren erklären zu können. Die PKK hat stattdessen mit der syrisch-kurdischen Gesellschaft sich in derselben konflikthaften Weise zu arrangieren wie mit der türkisch-kurdischen früher schon; und das schliesst eine widerspruchsvolle Anerkennung der Errungenschaften der Revolution mit ein.
Alles das, wofür „Rojava“ so berühmt wurde, wurde in der syrischen Revolution entwickelt, noch ehe die PKK überhaupt eine Rolle spielte. Schon in der frühesten Phase der Revolution, in der landesweiten Protestbewegung, haben Leute wie Omar Aziz aus den unmittelbaren Bedürfnissen der Bewegung lokale Koordinationskomittees gegründet und diese landesweit koordiniert; als Organe nicht nur der gegenseitigen Selbsthilfe, sondern als Organe der Revolution selbst. Mit weiterem Fortschreiten der Revolution dehnte sich die Tätigkeit dieser Organe immer weiter in die früher vom Staat beherrschte Sphäre aus, und zerschnitt dessen Machtbasis fortschreitend, während sie die Organisierung der revolutionären Gesellschaft immer weiter befestigte. Die PKK hat die Selbstverwaltung in Syrien nicht erfunden, sondern sie vorgefunden, eingerahmt, und benutzt sie natürlich zu ihrer Propaganda.
Die erstaunliche Zähigkeit der revolutionären Strukturen zeigt sich daran, dass es dem Regime in fünf Jahren Krieg nicht gelungen war, wieder Herr der Lage zu werden. Omar Aziz sagte im November 2012, kurz vor seinem Tod in einem syrischen Gefängnis: „Wir sind nicht schlechter als die Arbeiter der Commune. Die hielten 70 Tage stand. Wir sind nach eineinhalb Jahren noch da.“ Und er hatte Recht, und es war noch lange nicht vorbei. Bis 2019 haben die letzten dieser Organe ausgehalten, und schon zeigen sich die Umrisse eines neuen Anlaufs.
Die PKK hat, genau in dem Moment, als das Regime sich zu einer militärischen Lösung entschlossen hat, die Entscheidung getroffen, den Norden aus dem Krieg herauszuhalten. Sie hat dem Regime die militärische Lösung überhaupt erst möglich gemacht. Assad hätte nie den Krieg gewinnen können gegen den Süden und den Norden gleichzeitig. Ist es also ein Verdienst der PKK, dass die gewaltsame Niederwerfung, der ungeheure Konterrevolutionskrieg den Norden grossenteils verschont hat? Aber sie haben dazu den Rest Syriens den Wölfen vorgeworfen, und das bleibt ein Makel, der nicht abgewaschen werden kann; ja noch mehr, es zwingt sie dazu, über diese Geschichte zu lügen, und es zwingt ihre Anhänger zu der gleichen Lüge. Man hat die Araber Syriens als islamistische Terroristen gezeichnet und zum Abschuss freigegeben. Diese Komplizenschaft wird die globale Linke noch sehr lange vergiften.
Die grundlegende Dynamik in syrisch-Kurdistan ist keine andere als die in der Türkei früher: ein ungeheures Segment der Gesellschaft ist in Bewegung geraten und versucht, an einer wirklichen Veränderung zu arbeiten. Aus dem einen oder anderen Grund muss es akzeptieren, dass der einzige Weg dahin über die PKK führt. Die PKK lässt, völlig treu ihrer langjährigen Politik, gesellschaftliche Organisierung zu; sogar konkurrierende Parteien, solange sie nur klein, irrelevant und leicht zu beeinflussen sind. So gibt es von der Nationalbewegung der assyrischen Christen im Moment 3 verfeindete Zweige, der kleinere hält zu Assad, die beiden grösseren zur PKK und zu Barzani. Aber als die Seele und einzige Garantin der Einheit der Gesellschaft, als Trägerin der politischen Idee steht die PKK da, und sie wird es nicht ändern lassen.
Die Vorschläge, die Macht mit oppositionellen kurdischen Parteien zu teilen, die Barzani und der KDP nahestehen, muss man einmal genau betrachten: es war die Rede von einem obersten Gremium, das paritätisch von der PKK und den Satellitenparteien der KDP besetzt wird. So etwas wird nie passieren. Aber es zeigt, aus welcher Vorstellungswelt diese Leute kommen. Hier die gerühmte Selbstverwaltung, von der alle Macht ausgeht – aber darüber die Partei, die ganz selbstverständlich die oberste Hoheit hat, und diese sogar mit einer anderen Partei teilen könnte. Dieses Friedensangebot ist natürlich absichtlich undurchführbar. Aber die gegnerischen bewaffneten Gruppen wissen natürlich alle, dass sie Verhandlungen führen nicht mit der Selbstverwaltung, also einem Haufen von Gemeinderäten, sondern mit der PKK.
Arbeiten wie die von Flach, Ayboğa, Knapp zitieren haufenweise Aktivisten, die sich vollkommen überzeugt geben, dass Gesellschaft und Partei in syrisch-Kurdistan so fugenlos identisch sind, dass einem die Tränen der Rührung kommen. Diese Erscheinung ist, wenn man alles berücksichtigt, leicht zu erklären. Die fugenlose Loyalität ist das einzige Mittel der Gesellschaft, auf die PKK Druck auszuüben; die PKK als ihr Werkzeug betrachten zu können, statt andersherum. Es ist aufschlussreich, weil es so gut dokumentiert ist. Und es ist wahrscheinlich nicht nur hier so, sondern erklärt vielleicht allerhand Dinge, die man anderswo auch sieht.
Aber ohne den Kontext, was sagt einem diese Erscheinung? Weniger als nichts. Es sind aber noch ganz andere Schlüsse zulässig. Die PKK hat unter dem Druck solcher Loyalität ihre Doktrin oft genug geändert: von kurdischen Separatismus und Sozialismus leninistischen Typs zu etwas, das sie demokratischen Konföderalismus nennt. Aber über diese Häutungen hinweg ist sie doch in einem Punkt die gleiche geblieben. Sie wechselt das, was man ihre politischen Ideen nennt, nach Belieben aus; sie greift übrigens auch gerne noch auf die alten zurück, wenn Bedarf ist. Aber was ist denn die Konstante, genau? Das Eigeninteresse der Organisation? Aber die Kader werden genauso plötzlich ausgetauscht wie die Ideen, entmachtet, Säuberungen unterworfen, hin und hergeschickt, selbst die oberste Führung steht auf schwankendem Boden und ständig an der Grenze zum Hochverrat. Denn die Kommandos des Orakels von Imrali sind ja nicht plötzlich weniger undurchführbar, unvorhersehbar und unlogisch geworden.
Vielleicht bietet die PKK einen einzigartigen Einblick in das Wesen der politischen Ideen überhaupt. Sie sind leer und abstrakt. Sie sind ihrem Inhalt gegenüber völlig gleichgültig. Man kann jeden konkreten politische Inhalt von einem Tag auf den anderen loswerden. Was man damit nicht loswird, ist die Form der politischen Idee selbst: die Idee des zentralen Subjekts, das für die Gesellschaft denken soll; und gerade das ist, was man dringend loswerden muss. Die politische Idee ist die Platzhalterin der Staatspartei im Denken.
3.
Betrachten wir unter diesem Aspekt einige militärische Fragen der syrischen Revolution in den veschiedenen Landesteilen. Wie organisiert eine Gesellschaft in Revolution denn ihre Verteidigung? Das Problem ist eine verschärfte Fassung des allgemeinen Problems. Die Gesellschaft bringt nicht ohne weiteres von sich aus einen Punkt hervor, an dem sie ihre Einheit hat. Das Problem der Koordination ist nicht ohne weiteres zu lösen.
Als der sogenannte Islamische Staat (Daesh) auf Kobane marschierte, musste das von den Kurden (z.B.) als eine tödliche Bedrohung wahrgenommen werden. Der Wille, sich zu verteidigen, erzeugt aber nicht von alleine auch die Mittel, sich zu verteidigen, und zu diesen gehört auch eine funktionierende Organisation. Die PKK besass als einzige eine fertige Organisation; sie hatte auch keine anderen bestehen lassen. Die Lage ist ganz analog zu den bürgerkriegsähnlichen Zuständen im türkischen Südosten der 1990er Jahre: die einzige bestehende Organisation, das einzige Werkzeug der kollektiven Verteidigung war die Organisation der PKK. Der Deal, der gemacht werden muss, ist dieser: die PKK bietet der Gesellschaft sich als Organisation an, und die Gesellschat hat es mit Loyalität zu bezahlen.
Diese Allgemeinheit, die sie dadurch gewinnt, ist erschlichen und erzwungen. Sie hat als ihre Grundlage nicht die Gesellschaft und ihre Veränderung, sondern sie steht ihr eigentlich äusserlich gegenüber. Auch was sie etwa für die Gesellschaft tut, wird gewissermassen hinter dem Rücken der Gesellschaft getan sein. Umgekehrt ist nur durch völlige Loyalität, das heisst durch Anstrengung und Selbsttäuschung, irgendein Teil der Gesellschaft in der Lage, die Handlungen der Partei für freie Handlungen der Gesellschaft zu halten. Das lässt schlimmes ahnen. Sie steht eigentlich zur Gesellschaft nicht anders, als der Staat steht. Sie wird der Gesellschaft gegenüber undurchdringlich bleiben, auch wenn ihr geliebter Führer noch so viel Staatskritik treibt. Der sogenannte Islamische Staat ist zurückgeschlagen fürs erste, immerhin, aber dem Problem, wie die revolutionäre Gesellschaft zu einer angemessenen Organisation findet, wird man keinen Fussbreit näher kommen.
In den arabischen Landesteilen gab es einen anscheinend völlig anderen Verlauf. Seit dem Beginn der militärischen Phase, das heisst seit dem Beginn der militärischen Angriffe auf die syrische Gesellschaft (und seit dem Abfall des kurdischen Nordens) organisierten einerseits die lokalen Komittees eine territoriale Verteidigung, bestehend aus ehemaligen Soldaten und Wehrpflichtigen; andererseits aber fielen ganze Truppenteile samt ihren Generälen von dem Regime ab und gründeten die Freie Syrische Armee. Drittens aber gründeten eine Reihe Organisationen des Exils, oder kaum organisierte Intellktuelle des Inlands, zusammen mit abgefallenen Militäroffizieren den Syrischen Nationalrat (SNC).
Diese drei Elemente vertragen sich nun nicht ohne weiteres. Die lokalem Kommittees, getragen von den besitzlosen Klassen, und die kleinen lokalen Einheiten von ehemaligen einfachen Soldaten und Unteroffizieren auf der einen Seite, und die Armeegeneräle auf der anderen Seite, sind an sich nicht unter einen Hut zu bringen; denn wie sollte ein General sich bereit erklären, sich einem Haufen von Gemeinderäten zu unterstellen? Das Schicksal des Dumouriez in der französischen Revolution wollten sie sich ja doch ersparen. Aber auch dazu hätte es eine landesweite Führung gebrauch; einen landesweiten Kongress von Vertretern der Gemeindeorgane. Und der kam gerade nicht zustande, stattdessen ein Ausschuss der vorrevolutionären Parteien des Exil.
Es war ein grosser Fehler, dass man diesen Leuten nicht sofort das Misstrauen ausgesprochen hat, aber was konnte man tun? Das Problem war gerade, dass man unter Angriff geraten war. Es brauchte dringend eine anerkannte zentrale Instanz, von der eine militärische Führung eingesetzt werden konnte; denn die bloss lokale Territorialverteidigung durch demokratische Teilzeitmilizen konnte gegen die 4. Mechanisierte Division, den wirklichen Kern des syrischen Armee, nicht ankommen. Denn was von der syrischen Armee übriggeblieben war, reichte zwar nicht hin, das Land wieder unter Kontrolle zu bekommen; es war aber mehr als ausreichend dafür, Tod und Verwüstung zu säen und die Revolution zu ständiger Verteidigung zu zwingen.
Die gegnerischen Parteien waren völlig unsymmetrisch; nicht nur, was die Bewaffnung angeht, sondern vor allem in ihren Zwecken und ihren Schwächen. Die Revolution war von den einfachen Leuten gemacht, und sie war gezwungen, die einfachen Leute zu schützen. Das Regime hatte dagegen fast nichts, auf das es Rücksicht nehmen musste; es reichte hin, dass es töten konnte. Dazu brauchte es nichts anderes, als dass die mittleren Schichten, die die Luftwaffe und die mechanisierten Brigaden stellte, sich einbilden durften, hinter der Revolution stünde ein islamistisch-imperialistisches Komplott.
Die lokalen Räte aber brachten eine landesweite Vereinigung unter diesen Bedingungen natürlich nicht zustande, sondern mussten, genau wie im Norden, diejenige Organisation adoptieren, die man ihnen anbot. Und hat nicht, anders als die PKK, diese Organisation in Spaltung und Niederlage geführt? Ja, diese Organisation, und dazu die Fassbomben, die Giftgasangriffe, die schonungslosen Artilleriebombardements. Hätte ein anderer Nationalausschuss als der SNC ein anderes Ergebnis bringen können? Das Problem ist ja vielleicht nicht nur, dass der SNC aus lauter Intriganten bestand, die genau wussten, dass sie ohne die Unterstützung ihres jeweiligen Patrons, der Türkei, des saudischen Tyrannen etc. genau nichts waren, und die es deswegen eilig hatten, die Revolution an diesen Patron zu verkaufen. Das Problem ist ja vielleicht struktureller Art.
Die spontan entstandenen Strukturen waren lokal gebunden, und für eine hinhaltende Defensive reicht das eine Weile aus. Die Strategie bestand aber gerade darin, einzelne Gegenden mit so schwerem Feuer zu belegen, dass die lokalen Strukturen nicht mehr halten können. Die Revolution wird direkt und mit Absicht gezwungen, in die strategische Offensive zu gehen, wo sie aber der Gnade und Ungnade der ihr fremden Leitung, der übergelaufenen Generale ausgeliefert ist; einer Offensive, die mit jedem Schritt jedem einzelnen ihrer bisherigen Organisationsprinzipien zuwiderlaufen muss, schon allein indem nämlich z.B. Kräfte von dem einen Ort an den anderen abgezogen werden müssen, und zwar über die Köpfe des lokalen Rats hinweg.
Gerade indem ihnen diese Strategien aufgezwungen wurden, wurde ihnen aber die Möglichkeit genommen, eigene angemessne Strukturen dafür zu bilden. Diejenigen Kräfte, auf die sie sich stattdessen stützen mussten, fürchteten nichts so sehr, als den einfachen Leuten, ihren neuen Dienstherren, in die Hände zu fallen. Sie mussten also den Prozess der Organisierung einer revolutionären Territorialverteidigung nach Möglichkeit behindern, und stattdessen sich ausländischer Hilfe bedienen; das plötzliche Aufkommen der grösseren islamistischen Verbände, die die Einheiten der revolutionären Territorialverteidung verdrängte, kommt daher.
Jedenfalls aber waren jedenfalls die abgefallnen Generäle noch die vorrevolutionären Parteien des Nationalrats die richtigen Leute, um das einzige zu tun, was noch getan werden konnte, nämlich den revolutionären Enthusiasmus zu entfesseln und zu nutzen; weil dieser Enthusiasmus genau sie hinweggefegt hätte, auf die eine oder andre Weise. Die PKK konnte sich solche Massregeln leichter leisten; weil sie wusste, dass an ihr ohne weiteres kein Weg vorbei ging, erst recht, als die Sache im Norden vorläufig ins kurdisch-nationale Fahrwasser gelenkt war, um so mehr später, als es ihr gelungen war, indispensabler Verbündeter der USA, und Treuhänderin der amerikanischen Interessenzone östlich des Euphrates zu werden.
In dieser ganzen Geschichte liegt ein viel tieferes Problem vergraben. Die Revolution kann ernsthaft auf keine dieser Weisen vorgehen. Sie führen alle in die Irre. Das Problem der Verteidigung kann nicht verstanden werden ohne das Problem der gesellschaftlichen Einheit, d.h. ans Problem des Staats. Es ist deswegen nicht kurzfristig lösbar. Es ist hier nicht eine bestimmte Lösung vorzuschlagen. Es ist alles noch am Anfang. Die Bewegung wird noch ganz andere Lösungen ausprobieren müssen, um das Problem für die kurze und die mittlere Frist zu umgehen, so dass es handhabbar wird, ohne den Weg zu einer gründlicheren Lösung zu verstellen. Übrigens gilt dasselbe für alle ähnlich gelagerten Fragen, wir z.B. das Geld. Das syrische Pfund und sein Kurs bestimmen die Preise aller importierten und exportierten Waren; und es hängt auf vielerlei Weisen von dem Regime ab. Defensivmassregeln hiergegen haben ganz ähnliche Voraussetzungen wie die des Kriegs. Es ist übrigens ein reines Märchen, dass die PKK in Rojava auch nur entfernt etwas wie sozialistische Wirtschaft treibt.
Man kann, wollen wir zusammenfassen, natürlich nicht zusehn, wie Daesh auf Kobane marschiert. Man muss natürlich zu den Waffen greifen, unter dem Kommando derjenigen, die Kobane zu der Zeit halten und verteidigen. Aber man kann denen auch nicht zugestehen, das Kommando aus eigner Herrlichkeit zu führen. Die klassische Lösung früher war die Revolutionierung der Armee; auf eine bestimmte Weise geschieht diese tendenziell immer dann, wenn in einem Verteidigungskrieg die Armee gross und voller Freiwilliger oder Wehrpflichtiger wird, so dass das spezifische Gewicht der Offiziersklasse abnimmt. Aber gerade in dem Krieg ist die militärische Führung mächtig. Im Frieden dagegen, wo ihr Gewicht abnimmt, werden die Truppen reduziert, die Offiziersklasse gewinnt in der Truppe ohne weiteres die Oberhand; sie kann aussen leicht an die gesetzliche Kette genommen werden, bleibt aber im Inneren um so mehr autonom.
Ähnliche Logik lässt sich für jeden Zweig des Staatsapparats entwickeln. Zu jedem Zeitpunkt einer Revolution ist es möglich, dass irgendeine bereits bestehende Organisation sich als ein neues Regime festsetzt. Und genau damit wird unmöglich, dass die Revolution zu einem neuen Gesellschaftszustand fortgeführt wird.
Man hat das Problem der revolutionären Koordination von genau hieraus zu entwickeln. Der Kultus der Partei, der neuerdings überall mit einem Kultus der PKK verschwistert ist, ist dazu da, von solchen Schwierigkeiten abzulenken. Ihm geben sich gerne alle die hin, die ahnen, dass sie ohnehin gar nicht Teil einer Veränderung sein können oder überhaupt wollen. Sie hoffen allenfalls auf Fortdauer einer abgeleiteten privilegierten Relevanz. Muss man sie wo wichtig nehmen, wie sie sich selbst nehmen? Nur in dem Sinne, dass man sich hüten muss, dass ihre stumpfen Ideen nicht das einzige sein wird, dass verfügbar ist, wenn es einmal darauf ankommt.
Die Parallele zu Kronstadt 1921 führt in die Irre. Kronstadt ist falsch betrachtet, wenn man es abstrakt politisch betrachtet. Der gesellschaftliche Gehalt des bolschewistischen Staats war der Krieg des Kapitals gegen die Bauern. Das heutige faule Geschwätz von der Partei will davon nichts wissen; aber es vergisst auch, dass dieser gesellschaftlicher Gehalt für eine solche Partei heute in den meisten Gesellschaften gar nicht mehr besteht. Nach Kronstadt hatte es bis 2011 nur Revolutionen in Gesellschaften gegeben, die selbst noch vorherrschend agrarisch waren. Wenn es auf eine Revolution gegen das Kapital geht, statt für das Kapital, was soll sie da noch? Aber das heisst nicht, dass sie aufhören wird, die Lieblingsidee der Intellektuellen zu sein. Es geht wie mit dem Geld, sie wird erst verschwinden, wenn ihre Funktionen ersetzt werden können.
4
Es ist sehr interessant, dass über „Rojava“ alle die viel gutes zu sagen wissen, die über die syrische Revolution im Ganzen nichts gutes sagen. Noch interessanter, zu sehen, wie derselbe Riss sich durch einen Haufen andere Gegenstände zieht. Die „selektive Solidarität“, wie Leila Shami es nennt, mit „den Kurden“ ist selbst ein Element in der globalen Kampagne gegen „die Araber“, genauer gesagt gegen die Revolution unserer Zeit Es muss niemanden wundern, dass diese „selektive Solidarität“ auch in linken Kreisen vorherrscht. Es sind sich hier Leute einig, die sich sonst über nichts einig sind. Man musste sich wundern, wenn man sich noch über etwas wundern könnte.
Denn der neuere Riss liegt nicht nur über einem der älteren und tieferen Risse, sondern über gleich mehreren. Hinter der kollektiven Phantasie von der PKK erkennt man leicht die Umrisse älterer, mindestens ebenso siegreicher Parteien; das Aufgehen der Revolution im neuen Staat; hinter dem Bild von den Arabern aber die Furcht vor den gefährlichen Massen und ihrer hartnäckigen unterirdischen Macht.
Ein ganzer Schatz von Lügen hat sich zu Gewissheiten verdichtet, durch dieselbe unermüdliche Wiederholung, mit der diese Gesellschaft den Glauben an ihre Beständigkeit immer neu herstellen muss. Seine Elemente stammen aus dem 20. Jahrhundert. Aber die Zusammensetzung ist die unserer Tage. Die Debatte um die Grundlagen findet nicht in historischen, sondern in zeitgenössischen Kostümen statt: heute kann unwidersprochen ins Feld geführt werden, immerhin hätte die Partei vor Kobane bewiesen, was sie kann.
Die Debatte in den Kreisen der linken Intellektuellen konzentriert sich derweil auf die Frage der Organisation. Wichtig sei die, hört man. Aber sie können nicht verstehen: sie glauben, es käme darauf an, dass sie sich miteinander organisieren, anstatt mit den anderen Leuten, mit denen man arbeitet und neben denen man lebt. Daraus kann nichts gutes kommen. Dieses Stück wurde zu oft gegeben.
Kann denn die Gesellschaft des Staats, kann die Revolution der Partei entbehren? Wenn sie eigene Organe hervorbringen kann. Die Frage ist nicht: kann sie dieses, denn das weiss noch niemand, es ist zu selten versucht worden. Die Frage ist: wie kann sie dieses? Denn sie wird es ein ums andere Mal wieder versuchen. Ist das reine Illusion, wie sie Anarchisten sich machen? Aber die andere Möglichkeit läuft darauf hinaus, dass jedesmal eine neue Herrschaft aufgerichtet und jedesmal die neue Herrschaft wieder gestürzt werden muss, d.h. auf genau das gleiche. Das Zeitalter der Revolution muss zu einem Ende kommen. Die Gesellschaft ist gar noch nicht gegründet.