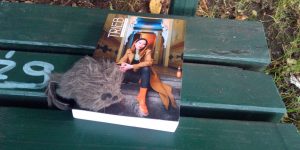Aus Heft 17
1
Wenn man über die heutige Gesellschaft etwas sagen kann, dann das, dass sie zum Entsetzen disfunktional ist. Das ist vielleicht nicht ganz neu, aber die Lage, in der wir uns sehen, ist in der Tat halbwegs neu; und es zeigt sich, dass die Gesellschaft von sich aus nach wie vor völlig ausserstande ist, ihre eigenen gemeinschaftlichen Angelegenheiten vernünftig zu regeln. Sogar noch mehr: sie ist noch nicht einmal in der Lage, einen klaren Gedanken über ihren eigenen Zustand zu fassen.
Die Gründe dafür sind nicht so oberflächlicher Art, wie man es oft hört. „Das Internet“ ist für die Mehrheit der Bevölkerung zwar tatsächlich neu, aber es schafft nicht die Konfusion, es beschleunigt sie nur; „Verschwörungstheorien“ sind nicht die Ursache der verbreiteten Desorientierung, sondern ihre Folgen. Auf der anderen Seite kann die letzte Ursache des Übels mühelos in der Verfassung der Gesellschaft selbst gefunden werden; in der Isolation und der unvermeidlichen Hilflosigkeit ihrer einzelnen Glieder; aber damit ist man von einer Handhabe immer noch weit entfernt.
Die Krise der jetzigen Gesellschaft spitzt diese Isolation und Hilflosigkeit weiter zu; es steht niemandem frei, sie einfach abzulegen. Aber jeder Ausweg ist unmöglich, wenn es nicht gelingt, sie wenigstens teilweise zurückzudrängen und Raum zu erobern, in denen Austausch und Koordination möglich ist. Solcher Raum kann als Ansatzpunkt für eine breitere Gegenoffensive dienen.
Nehmen wir als Beispiel einmal die neueste und unbegreiflichste Form dieser Krise, die neuere Corona-Epidemie. Ich glaube, nicht zu übertreiben, wenn ich die Reaktion der Gesellschaft wie folgt zusammenfasse. Als sich im März 2020 das Ausmass der Epidemie abzuzeichnen begann, hatte ein Teil der Gesellschaft schon spontan den sozialen Kontakt eingeschränkt, eine vernünftige Reaktion, und begann öffentliche Massnahmen zu fordern. Das scheinen mir meistens die Frauen gewesen zu sein. Erst langsam kam der Staat dem nach, und immer noch zögernd, und die Gastronomie wurde erst eine Woche nach den Schulen geschlossen.
Niemand hatte natürlich Vorsorge getroffen für eine solche Lage, die sozialen Dienste haben fast völlig versagt, und die Unzufriedenheit damit ist berechtigt. Öffentlich am lautesten geäussert wurde allerdings eine ganz andere Unzufriedenheit, nämlich die an gesellschaftlicher Seuchenbekämpfung überhaupt. Urplötzlich tauchten die allerirrsten Geschichten auf, es ist überhaupt nicht nötig, sie zu wiederholen, ein wimmelnder sich widersprechender Wust von obskuren Theorien, mit denen man sich jede Veränderung, sei sie noch so gering, vom Hals zu halten versuchte. Das verband sich schnell mit den grösseren Verschwörungstheorien, die den ideologischen Boden der neueren revolutionären Rechten bilden.
Die Reichweite aller dieser Geschichten sollte man nicht unterschätzen. Und es ist ja nicht so, dass ihr Vordringen von einer in sich zusammenhängenden Gegenansicht begrenzt wäre. Sondern was diese Gegenansicht im Inneren zusammenhält, ist der Rest von Vertrauen in die bestehenden Institutionen; ein Vertrauen, dass diese Institutionen aber nicht verdienen, und das sie nicht auf lange Dauer werden halten können. Wer wird dann einspringen?
Nehmen wir doch auch dafür die neuere Epidemie als Beispiel! Kann man über den Staat sagen, dass seine Massnahmen konsequent, sinnvoll, hilfreich gewesen sind? In Bayern muss man zum Einkaufen FFP2-Masken tragen, aber keineswegs auf der Arbeit. Weil? Oder: Nachdem die Staatsgazette „Bild“ ihre wüste Schlacht gegen Drosten gewonnen hatte, war der öffentliche Konsens der, dass Kinder in der Schule das Virus praktisch nicht ausbreiten. Also musste man, wie in Britannien, die Schulen offenhalten. In Britannien bildete sich dann eine Variante des Virus aus, die diesen Verbreitungsweg nutzen konnte: völlig absehbar breitet sie sich also schneller aus. Wie reagiert man? Man stellte die Flüge aus Britannien ein, aber man hielt zäh die Schulen offen.
Wer soll da das Gefühl haben, ihm würde die Wahrheit gesagt? Aber noch schlimmer: die Regierung hat die eigene Krisen-Kommunikation sabotiert. Sie hat aus Unfähigkeit die Verbreitung begünstigt und die Epidemie verschlimmert. Wird das öffentlich diskutiert? Opposition in dieser Gesellschaft besteht aus Leuten, die den sächsischen Ministerpräsidenten über dessen Gartenzaun anschreien, dass niemand, in Worten niemand an dieser Krankheit gestorben sei; und innerhalb der linken Szene aus Leuten, die dergleichen Opposition nicht den Rechten überlassen wollen. Haben sie Vorschläge, die sie nicht als komplette Trottel dastehen lassen? Ich habe keinen gehört.
Ich ziehe den Schluss: die heute bestehenden Kanäle der gesellschaftlichen Kommunikation sind katastrophal unfähig, sie bevorzugen Wahnsinn und Dummheit, und sie bringen die Belange des grösseren Bevölkerungsteils zum Schweigen. Es müssen ganz andere Arten von Dinge gesagt werden; das heisst, es muss über ganz andere Kanäle der Kommunikation nachgedacht werden.
2
Bedrückend muss das Gefühl gewesen zu sein, sowohl der Epidemie als auch der Verwaltung völlig ausgeliefert zu sein. Aber war man das notwendig? Die Gesellschaft hat eine grössere Fähigkeit zu gegenseitiger Selbsthilfe, als man ihr das gemeinhin zutraut. Sollte man sich wundern? Viele derjenigen Dinge, die die Verwaltung unterlässt, bleiben ohnehin auf den Schultern der Gesellschaft liegen, aber natürlich zunächst auf denjenigen ihrer Strukturen, die nicht ohne weiteres damit umgehen können, der Familien z.B.
In den frühen Tagen des Lockdown war z.B. an vielen Orten die Rede davon, gegenseitige Selbsthilfe in den einzelnen Wohnvierteln zu organisieren, Besorgungen für Leute in Quarantäne, Kinderbetreuung usw. Sehr oft wurde daraus nichts, weil einerseits niemand die Dinge kannte, die man in medizinischer Hinsicht zu beachten hätte, und andererseits niemand die Leute kannte, neben denen man wohnte. Es ist natürlich schwer, in einer solchen Situation die Grundlagen für Nachbarschaftsorganisation erst zu legen. Im Rückblick wäre es vielleicht die beste Chance gewesen, aber das war erst zu begreifen, als sie vorbei war.
Kirchengemeinden, sogar Fussballvereine begannen, solche Dienste anzubieten; schliesslich tat auch die Verwaltung so, als gedenke sie, sich zu kümmern. Diesen Anschein hielten alle aufrecht bis zu dem Moment, wo es darauf angekommen wäre, Ende 2020. Dann verdampfte das unter der Überlastung aller Strukturen; und was man den Sommer über bequem hätte aufbauen können, war jetzt völlig unmöglich ins Werk zu setzen.
Was die Gesellschaft aber so handlungsunfähig und so abhängig von der Obrigkeit macht, ist als erstes gerade das Fehlen von Kanälen der Kommunikation. Damit ist noch nicht einmal die technische Ebene gemeint. Es wäre einfacher, mit Wildfremden sich zu vereinbaren, wenn wenigstens eine Übung darin bestünde; eine Ebene bekannt wäre, auf der man überhaupt redet. Die Einzelnen sind radikal unkommunikativ, weil sie es niemals anders gelernt haben. Ohne Kommunkation aber keine Organisation.
3
Aber umgekehrt auch ohne Organisation keine Kommunikation. Man kann nicht einfach eines Mittwoch nachmittags bei den Nachbarn aufkreuzen und vorschlagen, sich doch aus keinem Grund zusammenzutun, ohne berechtigten Verdacht zu erwecken. Ohne ein wirkliches unabweisbares Bedürfnis treten Menschen nicht in Aktion, auch nicht in Verbindung.
Die Genossenschaften der alten Arbeiterbewegung hat viel beigetragen, die Klasse politisch zusammenzuhalten, solange es währte; es waren aber nicht die Reichtagsreden der sozialistischen Abgeordneten, oder das kommunistische Manifest, was sie stiftete, sondern das handfeste Bedürfnis. Welches sind heute solche Bedürfnisse, wo der Verbrauch der arbeitenden Klasse zum Gegenstand der Preiskämpfe der Discounter geworden ist?
Auch die anderen gesellschaftlichen Bedürfnisse selbst der abgehängtesten Schichten liegen ja nicht so offensichtlich zu Tage. Überall beansprucht irgend ein Teil der kommunalen Bürokratie, für sie zuständig zu sein. Für alles gibt es irgendwo eine Stelle, irgendwo Gruppen von Ehrenamtlichen. Aber der ganze Apparat funktioniert so, dass die Bedürftigen in Passivität bleiben.
Alle Beteiligten wissen, welche immensen Aufgaben liegen bleiben, aber das sind gerade diejenigen, für die immense Mittel aufgebracht werden müssten. Nehmen wir den neuesten unfreiwilligen Qualitätssprung in unserem Bildungswesen, Remote Learning. Es gibt Kinder, die anscheinend komplett vom Radar verschwinden, weil ihre Eltern die Rechner oder den Internetanschluss nicht haben, den man dazu braucht. Was würde eine Genossenschaftsbewegung tun? Man könnte Zentren in den Stadtteilen einrichten, in denen solche Rechner stehen; böse Zungen würden sagen, etwas funktionsgleiches habe es früher gegeben und man habe es Schulen genannt. Man könnte hausweise freie Bandbreite poolen; man könnte sich in Support Bubbles, wie es in England heisst, zusammenschliessen und Rechnerkapazität teilen. Alle diese Lösungen haben ihre verschiednen Schwierigkeiten und verschiednen Vorzüge, ich führe sie hier beispielhalber an.
Die verschiednen lohnarbeitenden Schichten wohnen oft deutlich voneinander getrennt, das erschwert gegenseitige Hilfe innerhalb der Klasse; bestimmte Lösungen kommen unter Epidemiebedingungen nicht in Frage aus den gleichen Gründen, warum auch der Präsenzunterricht eingestellt ist. Bestimmte Lösungen sind pandemiefest, aber haben andere Nachteile. Ein einheitliches dauerhaftes Selbsthilfenetzwerk müsste sich einstellen, sehr flexibel zu arbeiten. Es müsste vor allem aber schon vorher am Platz sein, jedenfalls in Ansätzen, und die Ansätze müssten von vorneherein erweiterbar geplant sein.
Welche der unabweisbaren wirklichen Bedürfnisse sind heute die geeignetsten, um solch einem Netzwerk stabile Verbreitung und Etablierung zu erlauben? Das lässt sich vermutlich nicht allgemein angeben. Es müsste ermittelt werden, aber das Elend ist, dazu bedarf es wiederum der Kommunikation.
4
Auch die Ermittlung der Bedürfnisse funktioniert nicht so, dass man mit einem Klemmbrett in der Hand eines Mittwoch nachmittags bei den Nachbarn aufkreuzt. Sie werden sie einem nicht sagen, und zwar nicht nur, weil sie einem nicht trauen oder nie gesehen haben, sondern weil sie diese Bedürfnisse gar nicht kennen. Und zwar dieses aus dem einfachen Grund, weil niemand jemals danach gefragt hat. Die knapp zahlreichste Gruppe der Bevölkerung besteht aus Leuten, deren Arbeit für alle Gesellschaft völlig zentral ist und deren Bedürfnisse seit Jahrtausenden als irrelevant gelten, sogar als öffentliches Gespött dienen, nämlich den Frauen. Diese unterdrückten Bedürfnisse müssen erst aus ihrer mühsamen Verdrängung entwickelt werden.
Ohne das ist an keine Veränderung dieser Gesellschaft auch nur zu denken. Die Krankheit dieser Gesellschaft, ihre Unfähigkeit, über ihre wichtigsten Angelegenheiten einen klaren Begriff zu bekommen: das entspricht vollkommen der Art, wie mit diesen Bedürfnissen umgegangen wird. Hier liegt das erste Hindernis der Veränderung, aber auch ein mächtiger Hebel.
Wie aber lassen sich solche Bedürfnisse entwickeln? Man geht nicht einfach hin und bildet sich ein, man weiss, was gut für die Leute ist und was sie wollen müssen. Sondern sie müssen sich in freier Selbsttätigkeit entfalten und eine Sprache selbst finden. Es handelt sich auch nicht einfach darum, dass Einschränkungen bestehen, die einfach aufgehoben werden könnten; sondern es kann niemandem unmittelbar klar sein, was er oder sie wirklich will, weil niemals die Möglichkeit bestand, darüber in Ruhe nachzudenken. Und in Ruhe, das heisst auch gar nicht alleine, sondern in Gesellschaft und Austausch. Genau dieser fehlt.
Was da tun? Wir besitzen ja doch einen konkreten Begriff von freier, selbsttätiger und schöpferischer Rede. Man nennt es die Kunst. Und die gesellschaftliche Literatur, der „angewandte Roman“ (Friedrich Schlegel) ist das Theater. Die moderne Kunst, namentlich die sogenannte avantgardistische, erhebt schon lange den Anspruch, gesellschaftsverändernd zu wirken; unterdrückte Bedürfnisse zu entwickeln; die Mittel des Ausdrucks zu befreien; einen Angriff gegen die bestehende Ordnung zu führen.
Glauben wir das? Ich habe neulich Zweifel daran geäussert: gerade der durch nichts gedeckte Anspruch, eine Avantgarde zu sein, eine abgetrennte und selbstherrliche Gruppe, die niemandem Rechenschaft schuldet, ist es, der das Vorhaben unmöglich macht. Die Hinterlassenschaft von 200 Jahren Avantgarde-Kunst müsste, um zu etwas noch nütze zu sein, radikal von dieser Perspektive aus neu untersucht werden: welche Gestalt nimmt sie an, wenn sie nicht mehr die Ansprüche einer kleinen Gruppe von Intellektuellen, sondern die Ansprüche der unterdrückten Mehrheit entwickeln sollte? Wie sähe eine massenhaft demokratische und radikale Kunst aus?
Das interessante ist, wir haben bereits Erfahrungen. Theater z.B. funktioniert ganz hervorragend und besser ohne das Hohepriestertum des Autors oder des Regisseurs, ohne den Geniekultus des spezialisierten Schauspielers. Dieser ganze Kram kann ohne weiteres auf den Müll. Die moderne Kunst hat schon jetzt besseres, einschneidenderes, machtvolleres gefunden; sie kann es sich nur nicht eingestehen, ohne ihr spezialisiertes Dasein aufzugeben. Diejenigen, die ein Stück entwickeln, unterscheiden sich von denen, die es ansehen, nur auf eine Weise unvermeidlich: dass sie länger sich damit beschäftigen. Jeder Gegenstand von einigem Interesse, aus dem man ein Drama machen kann, bietet unendlich Gelegenheit zu Überlegung, Erörterung und Urteil; und zwar befreit von einem unmittelbar drängenden Zweck, aber trotzdem angeleitet von dem Gegenstand. Je relevanter aber der Gegenstand, desto mehr schlägt solche kollektive Kunst in gesellschaftliche Debatte selbst um. Gerade wegen ihrer Realitätsferne kann die Form Kunst gegen eine Gesellschaftsordnung gekehrt werden, die selbst realitätsfern ist.
Es gibt natürlich einige theoretische Schulen für derartiges Theater, ausgedacht von Fachpersonal; einige interessanter, andere weniger. Aber man muss sich mit diesen nicht länger aufhalten, als man will; jedesmal, wo spezialisiertes Wissen zur Voraussetzung für solche Tätigkeit wird, hört diese Tätigkeit auf, frei und allgemein zugänglich zu sein. Kritische Intellektuelle haben nicht die Aufgabe der dauernden Anleitung; Prozesse, die mehr als einen nachhaltigen Anstoss benötigen und ohne dauernde Anleitung nicht ablaufen, sind künstlich und taugen nicht zur Selbstbefreiung.
5
Jeder Versuch, dauerhaft die Isolation zwischen den Gesellschaftsgliedern aufzuheben, wird sich auf mehr als einer Ebene bewegen müssen und sich mehrerer Mittel bedienen müssen. Umgekehrt kann keines dieser Mittel ohne Einbusse seiner Wirkung alleine betrieben werden. Sie unterstützen sich in ihrer Wirkung, aber sie behindern sich gegenseitig, wenn sie nicht gleichmässig entfaltet werden. Die Entfaltung der verdrängten Bedürfnisse hat den Status eines Versprechens, mehr nicht; sie bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Einlösung, der praktischen Unterstützung für die bereits bewussten Bedürfnisse. Die praktische Selbsthilfe aber bedarf dieses Versprechens, bedarf des Auswegs aus der Passivität; der Bereitschaft, nach dem bisher unmöglichen zu streben.
Solche sich gegenseitig bedingenden Tätigkeiten gehören also eigentlich schon räumlich zusammen. Die Frage nach dem Raum und seiner organisatorischen Struktur zieht die Frage nach sich, wie man die nötigen Ausgaben bestreitet; eine der letzten Rückzugsorte für Spezialistentätigkeit wird auf absehbare Zeit die Wissenschaft von den Fördermitteln bleiben. Es ist keine Schande, Förderungsmittel zu beziehen; besser wäre es, wenn es dessen nicht bedürfte. Fördermittel tendieren dazu, Abhängigkeit zu schaffen; aber man muss bedenken, dass auch jeder konkurrierende Akteur, die Vereine und die Kirchen, Förderungen beziehen. Die frühe französische Arbeiterbewegung hatte bei aller Staatsfeindschaft keine Scham, für ihre Bourses de Travail, Arbeiterbörsen, sich von den Gemeinden Häuser geben zu lassen. Sie hatte allerdings auch die Grösse, die Gemeinden dazu zu bringen.
Je unabweisbarer das gesellschaftliche Bedürfnis, in dessen Namen man auftritt, desto legitimer tritt man auch auf; desto eher ist man in der Lage, Räume und Möglichkeiten zu bekommen. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, sich Gegenden mit gemischter Sozialstruktur zu suchen. Die bestehenden Sozial- und Kulturangebote in gemeindlicher, kirchlicher oder freier Trägerschaft sollte man gut kennen; sie konstituieren im Guten wie Bösen die unmittelbaren Bedingungen der Tätigkeit.
Man sollte sich an keine der einzelnen unterdrückten Gruppen exklusiv binden, wenn das die Gefahr mit sich bringt, dass man sich den Zugang zu anderen Gruppen dadurch versperrt. Genau die Dynamik der Zwietracht sollte man im Gegenteil unterlaufen. Und man sollte niemals der Versuchung unterliegen, sich einzubilden, man hätte fertige, belastbare und überlegene Ideen, die man anderen nur nahe genug legen muss. Auch die eigenen Beschränkungen, bei unserer Leserschaft die des studentischen Milieus, müssen abgelegt werden. Auch wir wissen in Wahrheit erschreckend wenig.
Heisst das, die längst bekannte Stadtteilarbeit neu zu erfinden? Wahrscheinlich gar nicht unbedingt. Aber es liegt auch dort viel an Fähigkeiten brach, und es bleibt zu vieles ungetan; und das Bewusstsein fehlt heute in weiten Kreisen, was praktische Kritik (denn um solche handelt es sich) bedeutet, und wieviel davon abhängt. Es geht nicht um ein Haus mit einer roten Fahne, wo man seine Parties feiert. Es geht nicht um einen Raum, wo man seine Vorträge hält. Keine Sekte, keine Szene hat hier etwas zu suchen, keine Organisation, die nach Bestätigung ihrer eigenen Grundanschauungen suchen muss. Sondern es geht hier darum, die alte Gesellschaft aufzulösen, indem man eine andere beginnt. Die Eroberung der Mittel des Ausdrucks, die Revolution des alltäglichen Lebens; alle diese schönen Wörter, mit denen unsere Sekte gewohnt war zu hantieren, haben eigentlich keine Bedeutung, wenn nicht so.
Kollektivarbeit